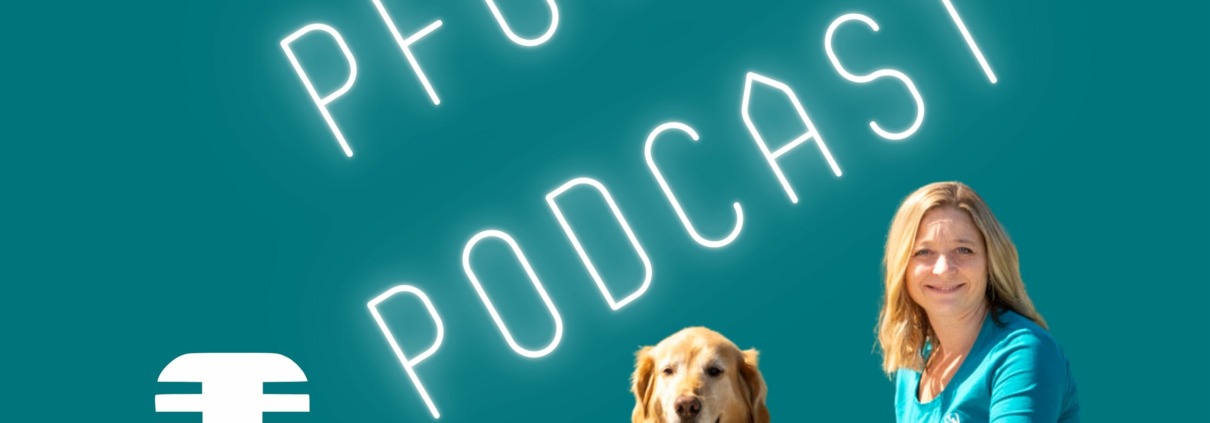Kennst du das Gefühl zu einer Veranstaltung hingehen zu müssen, aber keine Lust zu haben? Oder würdest du für dich alleine ein Essen kochen, wenn du gar keinen Hunger hast? Wärst du bereit Geld für eine teuere Jeans auszugeben, obwohl sie dir gar nicht gefällt?
Motivation entsteht, wenn ich den Sinn erkenne, wofür ich etwas mache, kurzum welches Ziel ich vor meinen Augen habe. Zum Beispiel: Ich habe Hunger, daraufhin wächst die Motivation zu kochen, damit ich mein Hungergefühl stillen kann.
Genauso ist es für die meisten Individuen. Nicht nur für uns Menschen, sondern genauso für unsere Tiere. Sie müssen den persönlichen Nutzen erkennen um die eigene Handlungsbereitschaft zu aktivieren. Ein anderer Begriff für Motivation ist “Verhaltensbereitschaft”. Ich bin bereit, ein Verhalten zu zeigen, weil ich motiviert bin.
So individuell die Tiere und Menschen sind, so unterschiedlich sind die Motivationsmöglichkeiten. Ich mache nur zu gerne den Exkurs in die “Menschenwelt”, damit du nachvollziehen kannst, warum der Hund was macht.
Aber nun tauchen wir ganz alleine ein in die spannende Welt der Hunde.
Grundbedürfnisse als Motivationsmittel im Hundetraining
Um die perfekten Motivationsanreize für deinen Hund zu ermitteln, ist es wichtig zu wissen, dass jeder Hund Grundbedürfnisse hat. Grundbedürfnisse sind beispielsweise ausreichend Fressen, Trinken, Spielen, Schlafen, das Erledigen von kleinen und großen Geschäften, Schnüffeln, Buddeln, eventuell Jagen, soziale Kontakte und Interaktion.
Nicht alle Grundbedürfnisse eignen sich als Mittel zur Motivation, aber die meisten lassen sich in verschiedenen Trainingsbereichen effektiv einsetzen. Dafür ist immer das Wissen erforderlich, was mein Hund in welcher Situation am tollsten findet. Außerdem darf der Bedarf von dem jeweiligen Grundbedürfnis nicht schon gesättigt sein.
Beispiel: Deinem Hund ist warm und er weiß, dass der kühle Bach in 15 Metern auf ihn wartet. Damit er aber nicht kopflos dahin stürmt, übst und trainierst du mit ihm, bis zum Bach hin, brav neben dir bei Fuß zu laufen. Nun seid ihr am Bach angekommen und jetzt stell dir kurz die Frage mit welcher Belohnung du deinem Hund wohl die größtmögliche Freude bereiten kannst?! Stimmt, mit der Erlaubnis im Bach zu baden!
Ein weiteres Beispiel, um zu verdeutlichen, warum ein gutes Motivationsmittel weniger Wert bekommt, wenn der Hund dieses zur ständigen Verfügung hat:
Du stellst deinem Hund den ganzen Tag über einen gefüllten Napf zur freien Verfügung hin. Dein Hund kann sich permanent daran bedienen. Nun bietest du deinem Hund draußen dasselbe Futter als Belohnung für eine schöne Leinenführigkeit an. Wenn du Glück hast nimmt er das Futter noch an, aber ein wirkliches Motivationsmittel für das Trainieren einer entspannten Leinenführung stellt das Futter nicht dar.
Führe dir nur stets vor Augen, die Sicherung der Grundbedürfnisse hat für deinen Hund oberste Priorität. Wenn dein Hund also während des Trainings Durst hat oder sich lösen muss, wird er sich nicht motivieren lassen eine Übung in Perfektion zu präsentieren, um danach eine Belohnung zu erhalten.
Warum ist die Motivationsfähigkeit bei allen Hunden unterschiedlich?
Die Motivationsfähigkeit ist oft rassespezifisch. Ein Herdenschutzhund versteht vielleicht die Welt nicht mehr, wenn du ihn mit einem Ball belohnen möchtest und schüttelt sich innerlich angewidert. Dagegen steht ein Retriever, der für den Ball das Dornengebüsch durchstreift und sich auch nach dem 100. Ballwurf noch so auf diesen freut, als wäre er gerade zum ersten Mal geflogen.
Die Erfahrungen in der Sozialisationszeit spielen ebenfalls eine große Rolle. Es gibt Hunde, die in der so wichtigen Phase das Spielen nie kennenlernen durften. Als Resultat sind sie meist mit einem Spiel eher weniger zu motivieren.
Ein Hund, der viele negative Hundebegegnungen hatte, wird sich wohl eher nicht für einen Freilauf mit einem fremden Artgenossen motivieren lassen.
Schlußendlich spielen diverse Stressoren eine große Rolle bei der Motivationsfähigkeit. Stressoren sind beispielsweise Schmerzen oder Krankheiten, Schlaf- und Ruheentzug, Druck und falschgesetzte Korrekturen im Training, Mangel an Belohnungen, für den Hund unverständliche Kommandogaben und Ablenkungen in der Umgebung.
Motivation und die stimulierenden Hormone – eine Party für den Hund
Bei dem Empfinden von positivem Stress mischt der Neurotransmitter Noradrenalin das “Partyfeeling des Hundes” auf. Im Zuge dessen werden Dopamin (Glückshormon) und bestimmte Endorphine ausgeschüttet. Dadurch kann dein Hund neu erlernte Inhalte besser speichern. Wer mit dieser Info aber jetzt meint, er müsste seinen Hund permanent in den 7. Himmel und darüber hinaus pushen, dem sei gesagt: “Die Dosis macht’s”. Zu viel Motivation, zu viel Dopamin und zu viel Endorphine bewirken das Gegenteil und es bleibt nach einer Trainingseinheit mehr Matsch im Hirn als positive Lernerfahrungen.
Entscheidend ist auch welche Übung du gerade machen möchtest, um zu entscheiden welches Motivationsmittel in der jeweiligen Situation am besten passt.
Möchtest du mit deinem Hund Deckentraining aufbauen, wird ein Zerrspiel deinem Hund keine passende Belohnung bieten. Belohnst du ihn aber nach einem super Durchlauf beim Agility mit einem Zerrspiel ist das für deinen Hund der 6er im Lotto mit Zusatzzahl und genau das richtige Motivationsmittel.
Trainingsfrust statt Motivationslust?
Bist du im Training körpersprachlich gut zu lesen? Bekommt dein Hund die Chance zu verstehen, was du von ihm möchtest oder arbeitet “dein Körper entgegengesetzt” deiner Kommandos?
Tipp: Filme dich mit deinem Handy während einer Übung. Gehe danach hin und schau dir dein Video ohne Ton an. Am allerbesten schaust du dir das Video erst einige Zeit später an. Und dann versuchst du nachzuvollziehen, was du mit deiner Körpersprache deinem liebsten Vierbeiner mitteilen wolltest. Spannend wird es, das verspreche ich dir! Du wirst mehr über dich als Trainingspartner für deinen Hund kennenlernen als dir vielleicht lieb ist.
Versuche dein Training immer wieder neu zu hinterfragen. Es ist nicht schlimm Trainingsfehler zu begehen, es ist nur schlimm, wenn du stur weitermachst und sie nicht bemerken willst. Dein Hund ist der beste Lehrmeister, denn er wird dir zeigen, wenn du ungenau bist, dann kann er nämlich nicht anders, als Fehler zu machen. Und aus jedem seiner Fehler solltest du lernen, ihm beim nächsten Mal das Training einfacher und verständlicher aufzubauen.
Steiger die Trainingsinhalte dabei immer langsam, gib deinem Hund Zeit den einen Schritt zu festigen, Vertrauen in die Übung aufzubauen und geh dann erst einen Trainingsschritt weiter. Du hast schließlich auch erst das Addieren mit einstelligen Zahlen perfekt erlernt, um es später im Hunderter Bereich zu können. Es wäre für Erstklässler so unfassbar unmotivierend, wenn sie bereits nach 2 Monaten 328 + 139 rechnen müssten.
Nun ist erwiesen, dass die aktive Mitarbeit des Hundes, und nicht das Vorkauen einer jeden Übung durch den Halter über jahrelanges Futterlocken, nachhaltig am effektivsten ist. Auch hier ist das richtige Maß entscheidend.
Motivations & Belohnungs-Hitliste
Nimm dir 5 Minuten Zeit, gönne dir einen Kaffee und schreibe die höchstpersönliche Hitliste an Trainingsmotivation für deinen Hund.
Wie in diesem Blogartikel bereits erwähnt, können die jeweiligen Motivationsmittel je nach Trainingsziel variieren, dennoch lohnt es sich eine Hitliste aufzustellen, um sie bewusst einzusetzen.
Die Hitliste deines Hundes könnte zum Beispiel so aussehen:
1. Ball an der Kordel
2. Leberwurst aus der Tube
3. Buddeln nach Mäusen
4. Spiel mit einem Artgenossen
5. Schnüffeln im Gras
6. Zerrspiel
7. über eine große Wiese flitzen
8. Kong mit Quark gefüllt
9. Baden im See
10. Streicheln
Meine Motivation wäre es, wenn ich dich nachhaltig begeistern konnte, dich mehr mit dem Thema Motivation auseinander zu setzen. Denn Motivation ist dein Schlüssel für eine gute Bindung und ein nachhaltiges Trainingsergebnis mit deinem Hund.
Ich freue mich, wenn du weiterhin Interesse an meinem Pfotenratgeber hast. Das ist meine Motivation.